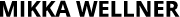The McGuffin-Bloc
2019
Mirrors, wood, uv-print, lamp, mattress, blanket, c-print, stones, book
Bärenzwinger, Berlin
Früh am Morgen wachte ich auf. Jedenfalls glaubte ich das. Ich wusste weder, ob es früh, noch ob ich überhaupt wach war. In meiner fensterlosen Kammer herrschte noch die Kühle der letzten Nacht und ich spürte meinen schmerzenden Körper. Es war ziemlich wahrscheinlich, dass ich mich nicht irrte.
Die Matratze, auf der ich schlief, war hart; ein Kopfkissen hatte ich nicht. Die dreckige Decke kratzte auf meiner Haut und eine Lampe leuchtete pausenlos ihr kaltes, distanzierendes Licht. Müdigkeit lag wie eine Maske auf meinem Gesicht. Ich streckte mich kurz, drehte mich um und schloss erneut die Augen. Ich hoffte, ich könnte den Traum der letzten Nacht fortsetzen. Darin lief ich durch Straßen mit riesigen Bäumen, alten Häusern aus roten Backsteinen und Menschen, die sich in die Augen schauten. Es war eine Welt, nicht unähnlich dieser, aber leichter und wärmer und dadurch etwas Anderes, etwas Besseres, als diese Insel hier. Mehrmals versuchte ich mich an das letzte Bild des Traumes zu erinnern und mehrmals scheiterte ich. Es half nichts. Ich widerstand dem Licht nicht mehr und meine Gedanken waren nun wieder genauso gefangen wie mein Körper. Die Schwere, die sich am Abend zuvor auf meine Lider gelegt hatte, verschwand, sobald das Gewicht der Träume verbraucht war. Es war wie ein Pendel, das zurückschlägt, nachdem der einen Seite die Kraft ausgeht. Müde stand ich auf und aß das Frühstück, das man mir hingestellt hatte. Vor langer Zeit hatte ich die Worte vergessen, mit denen ich das Essen beschreiben konnte und mit den Worten verlor ich auch das Interesse am Essen. Ich aß, weil ich essen musste, weil ich immer noch Hunger bekam. Egal.
Wie jeden Tag, verließ ich nach dem Frühstück die Kammer und betrat den westlichen Teil der Insel. Die Unterteilung der Insel in Himmelsrichtungen ist natürlich ein Witz. Das Stück Land ist so klein und überschaubar, dass selbst die Worte links und rechts unzutreffend wären. Draußen kämpften sich ein paar Sonnenstrahlen durch die gelben Blätter der Bäume und färbten die Insel in ein schüchternes Gold. Der Himmel war blass, wie eine fast vergessene Erinnerung. Ein Vogel flog über die Insel und verschwand so schnell wie er kam. Es gab keinen Grund sich hier aufzuhalten. Ich schloss die Augen, spürte einen leichten Windzug auf meinem Körper, hörte den Schlag meines Herzens. Ich atmete ein. Ich atmete aus. Selbst die Luft hier war müde und alt, träge und gelangweilt.
Ein Flüstern vertrieb meine Gedanken. Erst ganz leise, fast ein Hauchen, dann immer lauter werdend, drang es zu mir vor. Ich verstand es nicht und öffnete die Augen und sah dich wieder auf der anderen Seite des Grabens stehen. Du schautest mich an, wie du es seit tausenden Jahren machst. Vom ersten Tag an, schaute ich zurück. Am Anfang, als sich unsere Blicke zum ersten Mal trafen, waren sie voll Neugier und Interesse. Sie kommunizierten auf ihre eigene, stille Art, waren wohlwollend und liebevoll, so dachte ich. Sie waren sich ähnlich und geprägt von der heimlichen Hoffnung auf eine Entdeckung oder Erkenntnis, die Sinn und Bewusstsein schafft. Sie sehnten sich nach einer Ordnung und Orientierung die einem sagt, wer man ist oder wer man sein möchte. So verschieden wir auch waren, unser Sehen hatte den gleichen Ursprung und die gleiche Absicht. Wir waren beide auf der Suche und in unseren Blicken der Glaube, dass wir durch den anderen irgendetwas in uns entdecken könnten. Als wären wir Spiegel, die sich gegenseitig zeigen wer sie sind.
Aber mit jedem weiteren Tag, an dem ich dich und deine Welt beobachtete, leerte sich mein Blick. Den Grund dafür kannte ich nicht. Meine Augen nahmen alle Informationen auf, aber die Verarbeitung funktionierte nicht mehr. Ich, oder besser mein Gehirn, weigerte sich. Es konnte oder wollte nicht mehr die relevanten von irrelevanten Informationen unterscheiden und durch den Vergleich mit meinen Erinnerungen interpretieren. Ich glaube, es war gelangweilt von dir, der Welt und den sich ständig wiederholenden Bildern. Ab dem Zeitpunkt, ab dem ich wirklich verstand was ich sah, sah ich nichts Neues mehr. Ich sortierte das Gesehene und vergaß es sofort wieder.
Wenn wir ehrlich zu uns wären, dann wüssten wir, dass unsere Suche gescheitert ist. Wir entdeckten nur Dinge, die wir schon kannten und die wir einordnen konnten. Es gab keine neuen Impulse mehr. Ab diesem Zeitpunkt waren wir eigentlich blind, schauten aber immer weiter in der Hoffnung, uns entdecken zu können. Unser Sehen wurde zu einem reinen Selbstzweck, zu einer Sucht von der wir nicht mehr lassen konnten. Eine Sucht die uns bestimmt und zu einer Gewohnheit geworden ist. Eine ewige Wiederholung. Wir sehen um des Sehens Willen.
Die Sonne stand nun über den Bäumen und wärmte meine Haut. Der Wind lies die Blätter rascheln und weit entfernt sang der Vogel. Allein stand ich auf meiner Insel und du auf der anderen Seite des Grabens. Ich dachte an uns. Einst schautest du auf Menschen und Tiere, später auf Objekte. Ich, nur auf dich. Vielleicht fanden wir uns, vielleicht auch nicht. Aber jetzt herrscht in unseren Augen die gleiche Leere und wir haben die Frage gefunden, die uns verbindet: Was können wir noch erkennen, wenn wir schon alles gesehen haben?
The McGuffin-Bloc
2019
Mirrors, wood, uv-print, lamp, mattress, blanket, c-print, stones, book
Bärenzwinger, Berlin
Früh am Morgen wachte ich auf. Jedenfalls glaubte ich das. Ich wusste weder, ob es früh, noch ob ich überhaupt wach war. In meiner fensterlosen Kammer herrschte noch die Kühle der letzten Nacht und ich spürte meinen schmerzenden Körper. Es war ziemlich wahrscheinlich, dass ich mich nicht irrte.
Die Matratze, auf der ich schlief, war hart; ein Kopfkissen hatte ich nicht. Die dreckige Decke kratzte auf meiner Haut und eine Lampe leuchtete pausenlos ihr kaltes, distanzierendes Licht. Müdigkeit lag wie eine Maske auf meinem Gesicht. Ich streckte mich kurz, drehte mich um und schloss erneut die Augen. Ich hoffte, ich könnte den Traum der letzten Nacht fortsetzen. Darin lief ich durch Straßen mit riesigen Bäumen, alten Häusern aus roten Backsteinen und Menschen, die sich in die Augen schauten. Es war eine Welt, nicht unähnlich dieser, aber leichter und wärmer und dadurch etwas Anderes, etwas Besseres, als diese Insel hier. Mehrmals versuchte ich mich an das letzte Bild des Traumes zu erinnern und mehrmals scheiterte ich. Es half nichts. Ich widerstand dem Licht nicht mehr und meine Gedanken waren nun wieder genauso gefangen wie mein Körper. Die Schwere, die sich am Abend zuvor auf meine Lider gelegt hatte, verschwand, sobald das Gewicht der Träume verbraucht war. Es war wie ein Pendel, das zurückschlägt, nachdem der einen Seite die Kraft ausgeht. Müde stand ich auf und aß das Frühstück, das man mir hingestellt hatte. Vor langer Zeit hatte ich die Worte vergessen, mit denen ich das Essen beschreiben konnte und mit den Worten verlor ich auch das Interesse am Essen. Ich aß, weil ich essen musste, weil ich immer noch Hunger bekam. Egal.
Wie jeden Tag, verließ ich nach dem Frühstück die Kammer und betrat den westlichen Teil der Insel. Die Unterteilung der Insel in Himmelsrichtungen ist natürlich ein Witz. Das Stück Land ist so klein und überschaubar, dass selbst die Worte links und rechts unzutreffend wären. Draußen kämpften sich ein paar Sonnenstrahlen durch die gelben Blätter der Bäume und färbten die Insel in ein schüchternes Gold. Der Himmel war blass, wie eine fast vergessene Erinnerung. Ein Vogel flog über die Insel und verschwand so schnell wie er kam. Es gab keinen Grund sich hier aufzuhalten. Ich schloss die Augen, spürte einen leichten Windzug auf meinem Körper, hörte den Schlag meines Herzens. Ich atmete ein. Ich atmete aus. Selbst die Luft hier war müde und alt, träge und gelangweilt.
Ein Flüstern vertrieb meine Gedanken. Erst ganz leise, fast ein Hauchen, dann immer lauter werdend, drang es zu mir vor. Ich verstand es nicht und öffnete die Augen und sah dich wieder auf der anderen Seite des Grabens stehen. Du schautest mich an, wie du es seit tausenden Jahren machst. Vom ersten Tag an, schaute ich zurück. Am Anfang, als sich unsere Blicke zum ersten Mal trafen, waren sie voll Neugier und Interesse. Sie kommunizierten auf ihre eigene, stille Art, waren wohlwollend und liebevoll, so dachte ich. Sie waren sich ähnlich und geprägt von der heimlichen Hoffnung auf eine Entdeckung oder Erkenntnis, die Sinn und Bewusstsein schafft. Sie sehnten sich nach einer Ordnung und Orientierung die einem sagt, wer man ist oder wer man sein möchte. So verschieden wir auch waren, unser Sehen hatte den gleichen Ursprung und die gleiche Absicht. Wir waren beide auf der Suche und in unseren Blicken der Glaube, dass wir durch den anderen irgendetwas in uns entdecken könnten. Als wären wir Spiegel, die sich gegenseitig zeigen wer sie sind.
Aber mit jedem weiteren Tag, an dem ich dich und deine Welt beobachtete, leerte sich mein Blick. Den Grund dafür kannte ich nicht. Meine Augen nahmen alle Informationen auf, aber die Verarbeitung funktionierte nicht mehr. Ich, oder besser mein Gehirn, weigerte sich. Es konnte oder wollte nicht mehr die relevanten von irrelevanten Informationen unterscheiden und durch den Vergleich mit meinen Erinnerungen interpretieren. Ich glaube, es war gelangweilt von dir, der Welt und den sich ständig wiederholenden Bildern. Ab dem Zeitpunkt, ab dem ich wirklich verstand was ich sah, sah ich nichts Neues mehr. Ich sortierte das Gesehene und vergaß es sofort wieder.
Wenn wir ehrlich zu uns wären, dann wüssten wir, dass unsere Suche gescheitert ist. Wir entdeckten nur Dinge, die wir schon kannten und die wir einordnen konnten. Es gab keine neuen Impulse mehr. Ab diesem Zeitpunkt waren wir eigentlich blind, schauten aber immer weiter in der Hoffnung, uns entdecken zu können. Unser Sehen wurde zu einem reinen Selbstzweck, zu einer Sucht von der wir nicht mehr lassen konnten. Eine Sucht die uns bestimmt und zu einer Gewohnheit geworden ist. Eine ewige Wiederholung. Wir sehen um des Sehens Willen.
Die Sonne stand nun über den Bäumen und wärmte meine Haut. Der Wind lies die Blätter rascheln und weit entfernt sang der Vogel. Allein stand ich auf meiner Insel und du auf der anderen Seite des Grabens. Ich dachte an uns. Einst schautest du auf Menschen und Tiere, später auf Objekte. Ich, nur auf dich. Vielleicht fanden wir uns, vielleicht auch nicht. Aber jetzt herrscht in unseren Augen die gleiche Leere und wir haben die Frage gefunden, die uns verbindet: Was können wir noch erkennen, wenn wir schon alles gesehen haben?